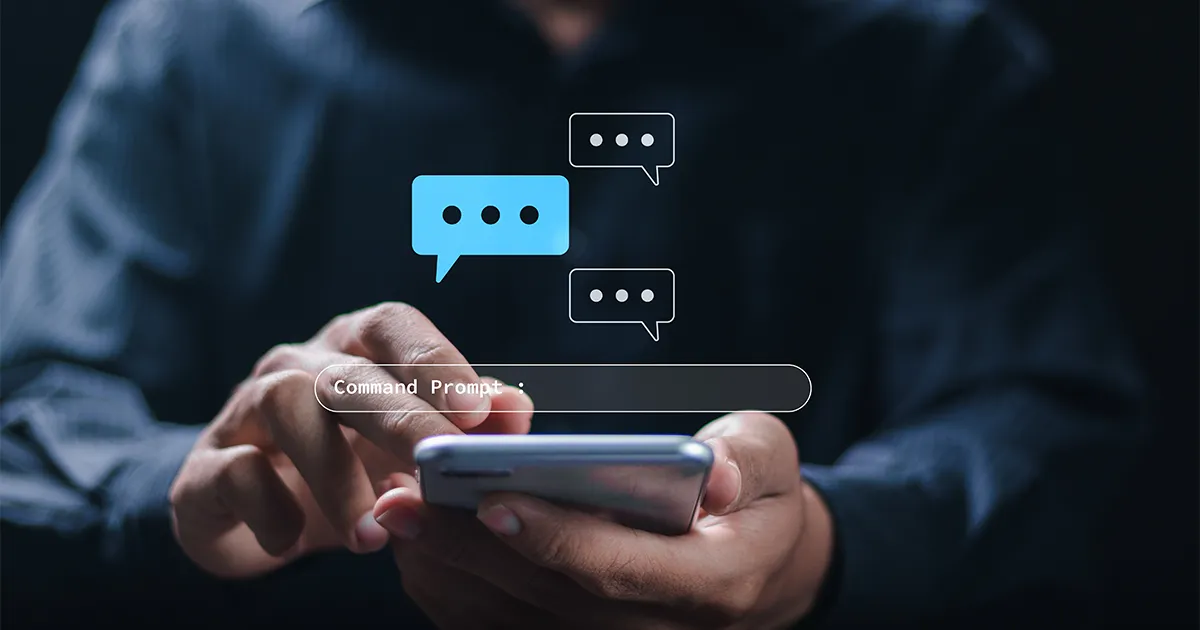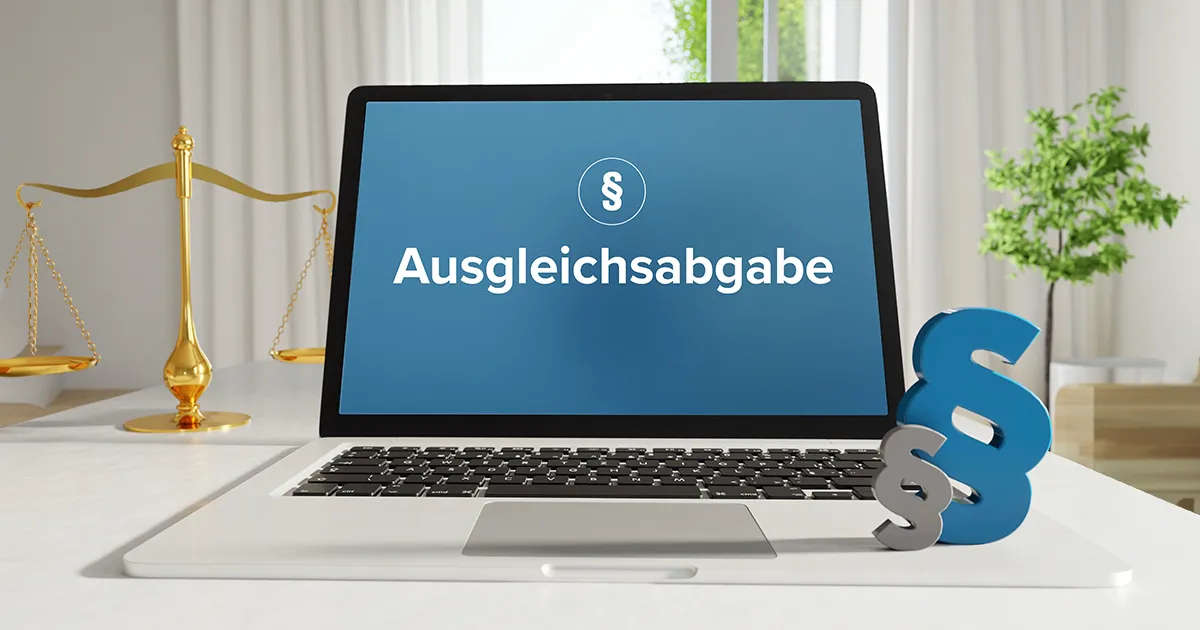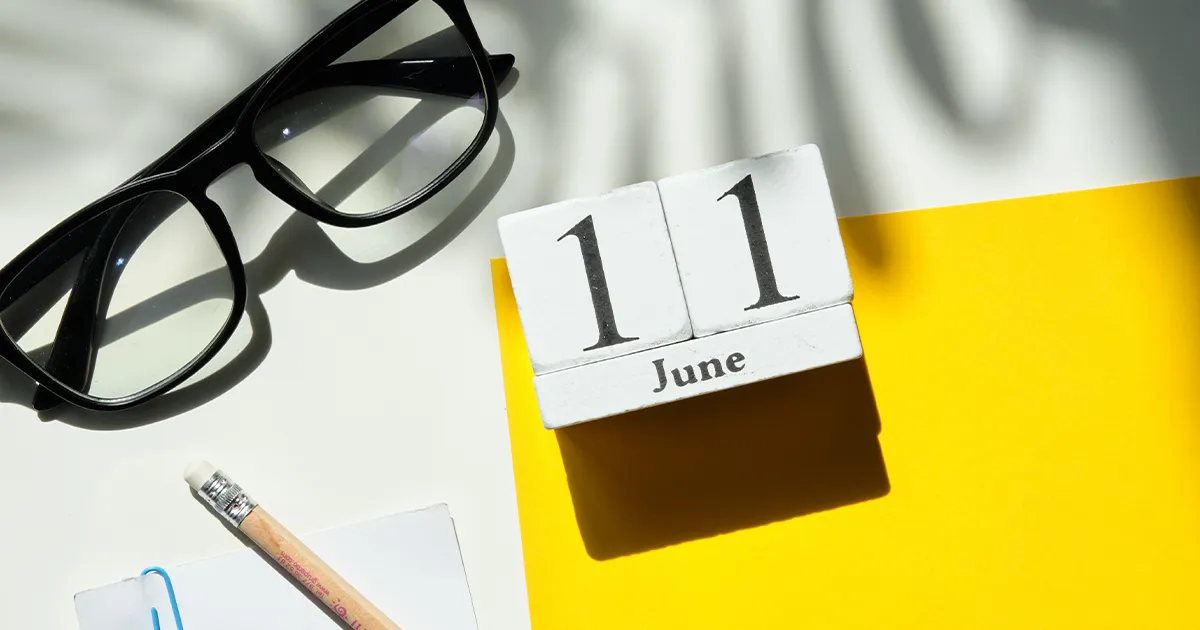Chancen und Risiken der Teamarbeit
Die Arbeit im Team kann für Gruppenmitglieder viele Vorteile mit sich bringen: Gruppen befriedigen das Bedürfnis nach Geselligkeit und Partizipation. Die Identifikation mit der Gruppe kann leistungsförderlich wirken, insbesondere wenn das eigene Team im Wettbewerb mit einer anderen Gruppe steht. Allein die bloße Präsenz (Mere Presence) anderer kann die Motivation erhöhen – zumindest bei der Bearbeitung einfacher Aufgaben. Soziale Anerkennung und sozialer Status spornen an und können sich positiv auf die Motivation auswirken. Teamarbeit hat also, wenn sie unter den richtigen Bedingungen stattfindet, positive Effekte auf die Motivation und Leistungsstärke der Gruppenmitglieder. Die einzelnen Mitglieder profitieren von einem Erfahrungs- und Know-how-Transfer. Sie verfügen über geteiltes Wissen und haben die Möglichkeit, Aufgaben anforderungs- und kompetenzgerecht untereinander aufzuteilen. Mit Blick auf Entscheidungen können sie unterschiedliche Perspektiven einnehmen und voneinander durch Beobachtung oder Nachahmung lernen.
Auf der anderen Seite erfordert Teamarbeit auch Koordinationsaufwand und die Führung von Teams ist häufig schwieriger als von einzelnen Mitarbeitern. Entscheidungen können unter Einbezug aller Teammitglieder länger dauern. Außerdem lassen sich Leistungen von Teams nicht präzise messen und einzelnen Gruppenmitgliedern zuordnen, so dass es zu Verantwortungsdiffusion kommen kann. Teamarbeit kann also auf der einen Seite Prozessgewinne mit sich bringen, d. h. eine Leistungsverbesserung durch die Gruppensituation. Auf der anderen Seite können aber auch Prozessverluste durch Koordinationsschwierigkeiten oder Motivationseinbußen auftreten.
Soziales Faulenzen, Sucker-Effekt & Co.
Nicht immer erbringen Gruppenmitglieder die volle Leistung: Manchmal trägt die Gruppensituation dazu bei, dass Teammitglieder ihre Leistung zurückhalten und weniger leisten als bei der Einzelarbeit. Folgende Gruppenphänomene werden in der Fachliteratur diskutiert:
- Ringelmann-Effekt: Dass eine kollektive Leistung geringer sein kann, als die aufsummierten Einzelleistungen erwartet lassen, hat der Agraringenieur Maximilien Ringelmann erkannt: Er ließ verschiedene Versuchsteilnehmer an einem Tau ziehen und fand heraus, dass die Zugkraft mit steigender Gruppengröße nicht wie erwartet linear anstieg. Vielmehr konnte er Produktivitätsverluste bei ansteigender Personenanzahl beobachten.
- Soziales Faulenzen (social loafing): Die Leistung eines Gruppenmitglieds verringert sich in der Gruppensituation, weil sein persönlicher Beitrag nicht identifizierbar oder bewertbar ist oder weil ein Vergleich mit der Leistung anderer Gruppenmitglieder fehlt. Das Risiko, dass ein Teammitglied seine Anstrengung reduziert, besteht z. B., wenn der individuelle Beitrag zum Gruppenoutput nicht messbar ist oder sich der Person nicht zuordnen lässt. Je größer die Gruppe, desto höher ist i. d. R. die Wahrscheinlichkeit des sozialen Faulenzens. Auch bei Routineaufgaben oder in Situationen, in denen vor allem individualistisch geprägte Personen zusammenarbeiten, tritt social loafing eher auf. Auf der anderen Seite kann es sein, dass sich Individuen in Gruppen entlastet fühlen und an schwierige Aufgaben mit einem geringeren Stressniveau herangehen. Um dem sozialen Faulenzen entgegenzuwirken gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, indem jedes Teammitglied einen individuellen Beitrag leistet und sich darüber im Klaren ist, dass dieser nicht überflüssig oder ersetzbar ist. Zum Ansporn können regelmäßige Rückmeldungen geleistet und zusätzliche Belohnungsanreize für den jeweiligen Beitrag angesetzt werden. Dazu muss die Leistung jedoch zurechenbar, messbar und transparent sein. Eine positive Wirkung entfalten kann auch eine Stärkung der Identifikation mit der Gruppe und des individuellen Verantwortungsgefühls.
- Trittbrettfahren (free-rider problem): Reduzieren Gruppenmitglieder bewusst ihre Anstrengung, weil sie ihren Beitrag zum Beispiel als verzichtbar oder unwichtig wahrnehmen, spricht man vom Trittbrettfahren: Die Leistungserbringung überlassen sie anderen Teammitgliedern, da diese, so die eigene Annahme, das Gruppenziel auch alleine erreichen können. Das Risiko, dass eine Person ihren Beitrag als überflüssig bewertet, steigt, wenn im Ergebnis vor allem die Leistung der Leistungsstarken zählt. Wichtig ist deshalb, die Relevanz des einzelnen Beitrags herauszustellen.
- Gimpel Effekt / Sucker-Effekt: Beobachtet ein Gruppenmitglied das Trittbrettfahren anderer Gruppenmitglieder, kann es sein, dass es seine Leistung zurückfährt. Diese Reaktion lässt sich als Protest dagegen deuten, von anderen, die sehr wohl zu einem Beitrag in der Lage wären, ausgenutzt zu werden und infolgedessen als Trottel (sucker) dazustehen. Ein häufiges Motiv für diese Reaktion ist der Wunsch, Beitragsgerechtigkeit herzustellen.
- Gruppendenken (Groupthink): Groupthink beschreibt das Phänomen, dass Gruppenmitglieder schlechtere Entscheidungen als möglich treffen, weil sie ihre Meinung z. B. zum Erhalt der Gruppenharmonie zurückstellen oder anpassen. Gruppendenken erhöht das Risiko von Fehlentscheidungen, wenn Entscheidungen zu schnell und realitätsfern getroffen werden. Groupthink tritt eher auf, wenn die Gruppenkohäsion hoch ist und die Gruppe eine hohe Homogenität einzelner Mitglieder aufweist. Gemischte, interkulturelle Gruppen können hier ggf. protektiv wirken. Außerdem können Führungskräfte für die Gefahr von Gruppendenken sensibilisieren, zur individuellen Meinungsäußerung ermutigen oder externe Personen hinzuziehen.
- Soziale Hemmung (social inhibition): Die Anwesenheit anderer kann zu einer Leistungsminderung führen, wenn sich die Person dadurch gehemmt oder unter Druck gesetzt fühlt. Das ist häufiger bei der Bearbeitung komplexer Aufgaben der Fall.
Positive Gruppenphänomene
Leistungsförderlich können sich u. a. folgende Gruppenphänomene auswirken:
- Soziale Kompensation (social compensation): Soziale Kompensation bedeutet, dass leistungsstarke Gruppenmitglieder sich mehr anstrengen, um die Leistung schwächerer Gruppenmitglieder auszugleichen. Dabei gilt die Voraussetzung, dass sie die Gruppenziele auch tatsächlich wertschätzen und erreichen wollen. In der Gruppe strengen sich die leistungsstärkeren Mitglieder in diesem Fall mehr an, um eine mögliche und unbeabsichtigte Minderleistung schwächerer Gruppenmitglieder zu kompensieren.
- Köhler-Effekt: Der nach Otto Köhler benannte Köhler-Effekt tritt vor allem in Gruppen auf, in denen die individuellen Leistungsunterschiede in einem vergleichsweise geringen Maß voneinander abweichen. Leistungsschwächere Gruppenmitglieder strengen sich mehr an, um zu vermeiden, dass sie das Gesamtergebnis negativ beeinflussen. Motive hierfür können ein hohes Verantwortungsgefühl für den Gruppenoutput oder Bewertungsangst sein. Leistungsstärkere Teammitglieder können in diesem Kontext eine Vorbildfunktion erfüllen. Durch den Köhler-Effekt kann so ein höherer Gruppenoutput zustande kommen, als bei der Addition einzelner Leistungen.
- Sozialer Wettbewerb: Der Wettbewerb unter Gruppenmitglieder oder zu anderen Gruppen kann anspornen. Dazu müssen bestimmte Wettbewerbsbedingungen gegeben sein: Die Beiträge und Erfolge der einzelnen Gruppenmitglieder sollten identifizierbar sein und die Mitarbeiter sollten in etwa über ein vergleichbares Leistungspotenzial verfügen, um nicht vor einem Wettbewerb zurückzuschrecken. Der Vergleich mit anderen kann anspornend wirken und zu höherer Anstrengung bewegen. Auf der anderen Seite kann die Konkurrenzsituation auch den Gruppenzusammenhalt gefährden.
- Social-Facilitation: Die Anwesenheit anderer kann dazu führen, dass Gruppenmitglieder Aufgaben erfolgreicher bewältigen. Dies ist bei einfachen oder gut gelernten, routinierten Aufgaben der Fall. Die Präsenz anderer kann dabei aktivierend wirken, so dass gelernte, dominante Reaktionen besser abgerufen werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass eine Person vor Zuschauern gut dastehen will und sich deshalb mehr anstrengt.
Fazit
Teamarbeit kann viele Vorteile mit sich bringen, zum Beispiel, wenn Teammitglieder einen Wissenstransfer leisten, Aufgaben anforderungsgerecht verteilen und die individuelle Motivation fördern. Positive Gruppenphänomene sind beispielsweise der Köhler-Effekt oder die soziale Kompensation. Auf der anderen Seite können Gruppenphänomene wie z. B. das soziale Faulenzen auch dazu führen, dass einzelne Gruppenmitglieder weniger leisten. Maßnahmen, die zum Beispiel die Zurechenbarkeit der einzelnen Beiträge ermöglichen und belohnen, können hier positiv wirken.
Diesen Beitrag teilen
Weitere Beiträge